Projektbeschreibung
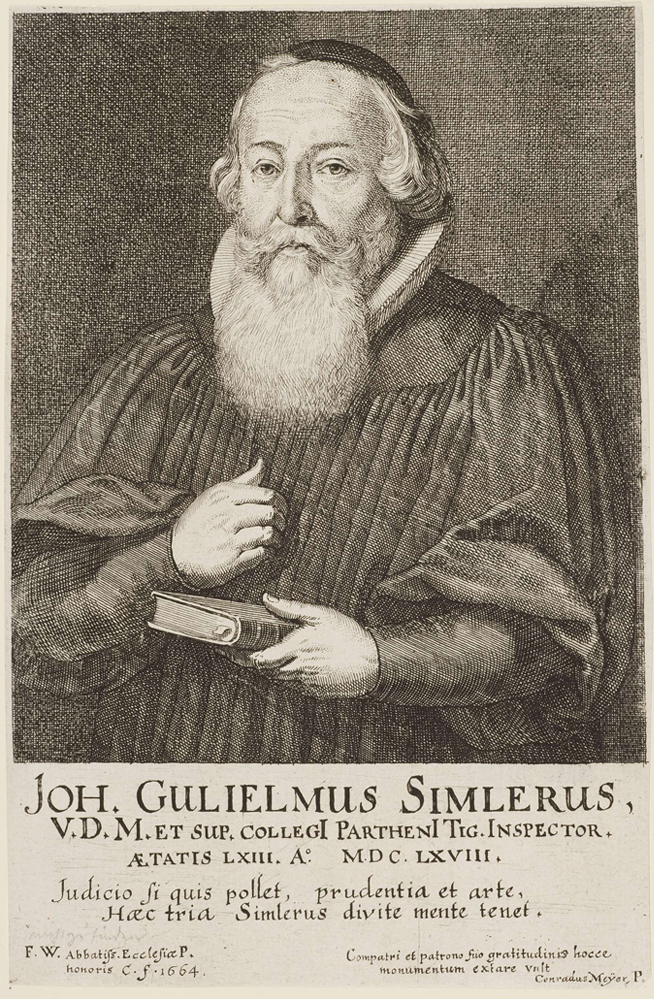
Druckgraphik: Conrad Meyer 1664
Das Projekt möchte mit dem 17. und frühen 18. Jahrhundert eine
vergessene Phase der Deutschschweizer Literatur neu
perspektivieren, nämlich die Epoche zwischen dem Ausscheiden der
Eidgenossenschaft aus dem Reichsverbund 1648 und dem bedeutenden
Literaturstreit zwischen Leipzig und Zürich ab 1730. Die Hypothese
lautet, dass sich in diesem Zeitraum sowohl ein ostmitteldeutscher
Standardisierungsanspruch als auch schweizerisch-städtische
Lizenzbehauptungen formierten, deren Spannung das sprachkulturelle
Selbstverständnis der Deutschschweiz im Grunde bis heute prägt.
Mit der Reformpoetik des Martin Opitz und dem Purismus der
barocken Sprachgesellschaften gerieten mündlich-dialektale
Traditionen in vielen Regionen des Reichs unter Druck. In der
gelehrten Öffentlichkeit der Deutschschweiz warf der neue Impuls
die Frage auf, ob sich die Eidgenossenschaft auch nach dem
Westfälischen Frieden einem gesamtdeutschen Sprach-, Literatur-
und Kulturraum zugehörig fühlen und sich dessen
Normierungstendenzen beugen solle, oder ob sie ihre
sprachkulturellen Varietäten und politischen Eigenheiten zu
behaupten vermöge. Die Antworten auf diese Frage werden vor allem
in der dichterischen Praxis gegeben und fallen so vielfältig wie
widersprüchlich aus. Die Forschungsgruppe soll die reformpoetische
Antinomie von Standardisierung und Diversifikation erstmals für
die besondere Situation der Deutschschweiz dokumentieren und
analysieren. Dafür fragt sie nach zeitgenössischen Akteuren und
ihren Aneignungspraktiken sowie nach Phänomenen formaler
Hybridisierung, Diglossie und Intermedialität.
Ein wichtiger Akteur in dieser Frage ist der Zürcher Zuchtherr und
Dichter Johann Wilhelm Simler. Seine Teutschen Gedichte (1648)
waren ein durchschlagender Erfolg. Sie wurden viermal aufgelegt
und teilweise ins Rätoromanische übersetzt. Mit seiner Edition
möchte das Projektteam erstmals Simlers künstlerische Netzwerke
erarbeiten und rekonstruieren, wie Simler sich gegenüber dem
reformpoetischen Projekt der Opitzianer positioniert. Mit seinem
vielschichtigen Werk, das Dichtung, Musik, Druckgrafik und weitere
Medien involviert, liegt ein einflussreiches Dokument aus der
Frühphase der Schweizer Literatur vor. Die Gratwanderung zwischen
Standardisierung und Lizenzbehauptungen, die man damals anstrebte,
prägt das sprachkulturelle Selbstverständnis der Deutschschweiz
bis heute.
Eine digitale Edition seines Hauptwerks bietet die Möglichkeit,
Simlers Netzwerke, seine literarisch-musikalischen Grenzgänge und
die orthographisch-typographischen Idiosynkrasien leicht fassbar
darzustellen sowie anhand der verschiedenen Ausgaben auch die
Entwicklung seiner an Opitz orientierten Reformdichtung
nachzuverfolgen. Die Edition soll nicht nur der Fachwelt als
Arbeitsinstrument dienen können, sondern auch für eine
interessierte Öffentlichkeit aufbereitet sein. Eine begleitende
Dissertation wird erstmals die Opitz-Rezeption in der
Deutschschweiz auf breiterer Basis von Simler bis zu Johann Jakob
Bodmer und Johann Jakob Breitinger untersuchen. Besonderes Gewicht
legt sie auf die produktiven Brüche mit reformpoetischen Vorgaben,
auf Mischformen und Experimente sowie auf die produktive
Konvergenz von Standard und Dialekt.